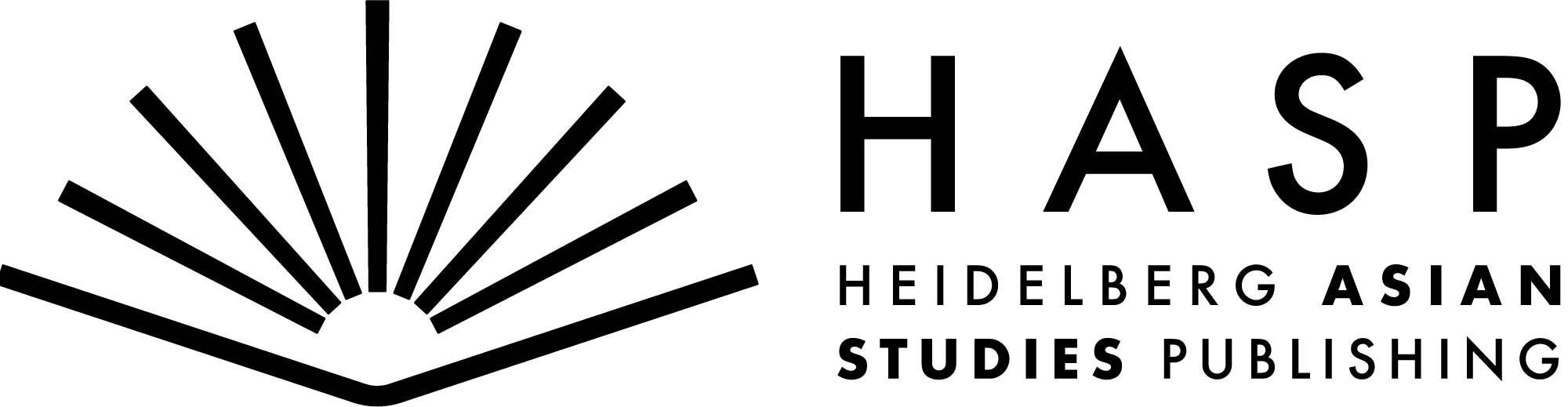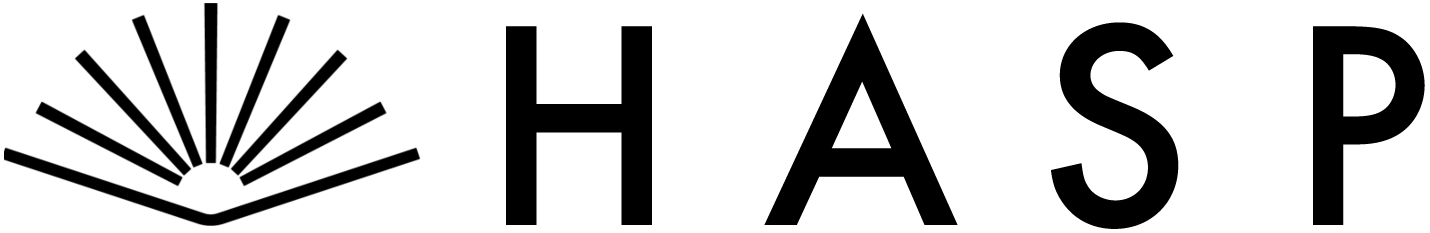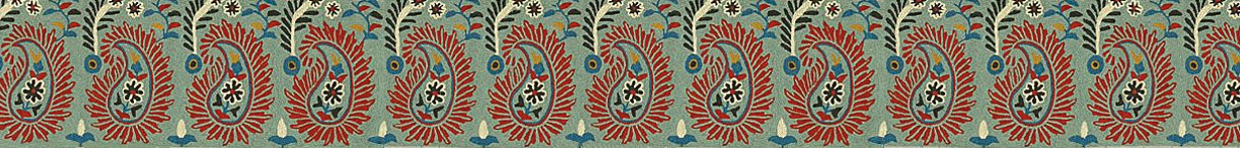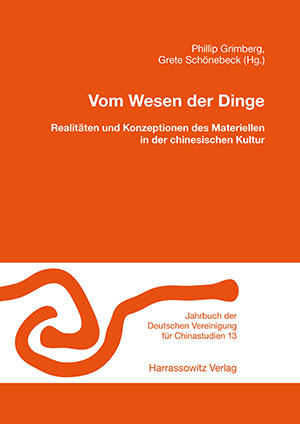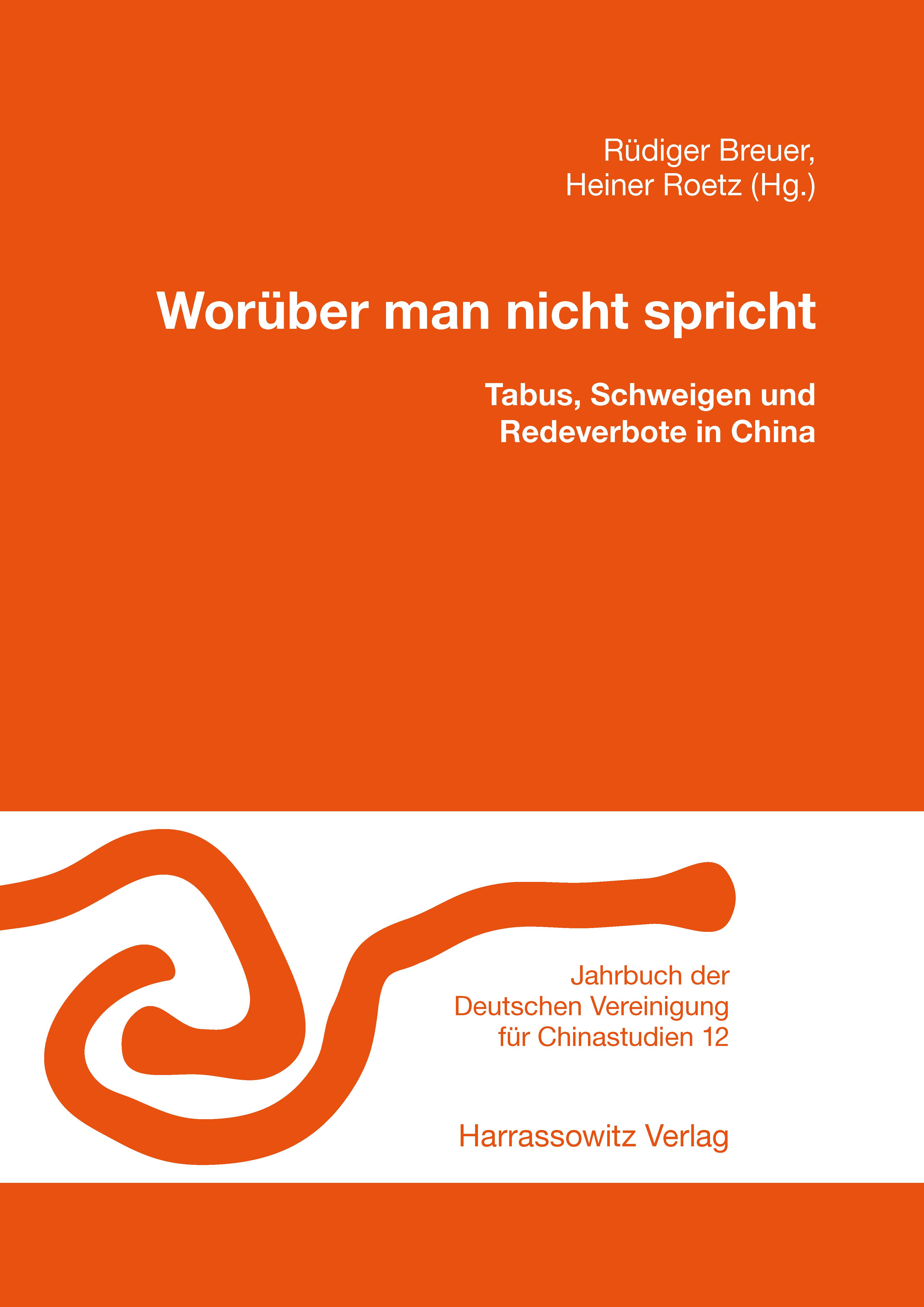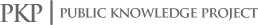Nagel-Angermann, Monique
Vom Wesen der Dinge: Realitäten und Konzeptionen des Materiellen in der chinesischen Kultur
Von dieser Annahme ausgehend werden in diesem Band die Beweise materieller Kultur Chinas aus ganz verschiedenen Perspektiven und mit sehr unterschiedlichen methodischen Zugriffen untersucht. Das in den hier versammelten Aufsätzen abgebildete thematische Spektrum reicht u.a. von soziologischen Untersuchungen moderner Machtarchitektur und einer Ethnographie des Recyclings von Bauschutt im gegenwärtigen China über die literaturwissenschaftliche Analyse sogenannter „Dinggedichte“ bis hin zu Fragen sozialistischen Möbeldesigns und dem Problem des Kulturbegriffs in der chinabezogenen archäologischen Forschung. Allen Beiträgen gemein ist jedoch der Versuch, den Dingen dialogisch zu begegnen und diese dabei „zum Sprechen“ zu bringen.
N.B.: Aufgrund einer unvollständigen Herausgeberangabe auf der Titelei des Buches wurden sowohl die PDF-Datei des Buches als auch die PDF-Datei der Titelei am 24.11.2021 ausgetauscht.
Worüber man nicht spricht: Tabus, Schweigen und Redeverbote in China
Self-imposed or socially or state-imposed speech taboos have always accompanied Chinese cultural history, as have attempts to break or circumvent them. Not only philosophy, historiography and literature have stood in this field of tension, but also moral and political action, which is still confronted with speech taboos today.
Worüber man nicht spricht gathers eleven contributions that span an arc from Chinese antiquity to the present day and illuminate the topic from various perspectives. They are examined: Cases of incest in ancient China; the problem of domestic violence in contemporary China; the originally strictly confidential "family teachings of Zhu Xi"; guidebook literature on China with its recommendations and prohibitions; the criticism of the republican writer and intellectual Lu Xun of mechanisms of power; the orientation of research on the 'Book of Changes' (Yijing); political factionalism in the one-party state of China; the linguist Wei Jian¬gong and his justifications of language policy measures; the political commitment of the filmmaker Shi Hui in the 1940s and the activities of the performance artist He Yunchang in the political and social context of the People's Republic of China. In this way, a multifaceted picture of taboos and prohibitions of speech in China's past and present is created.