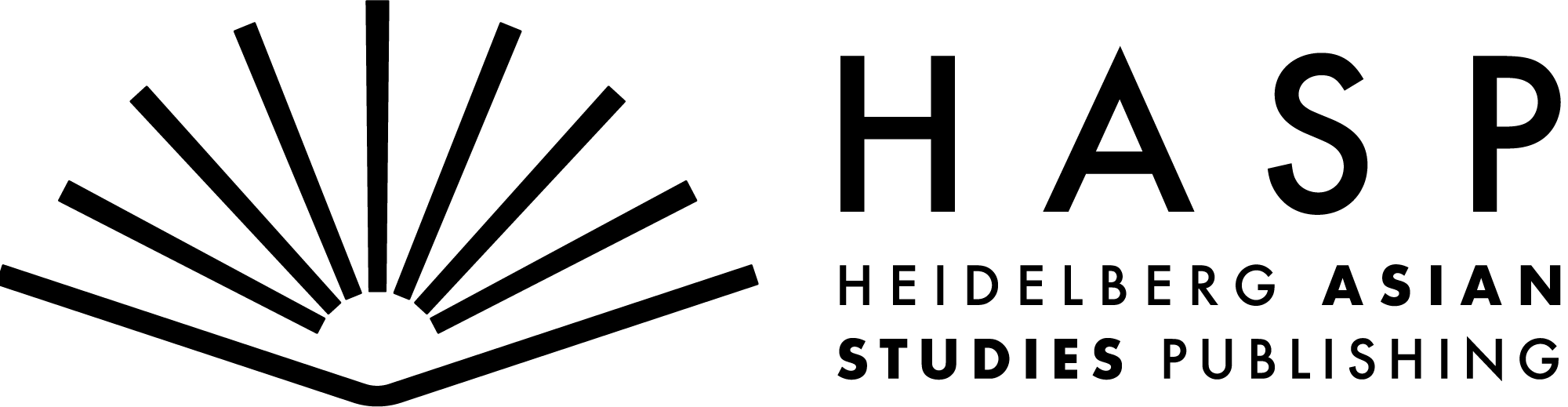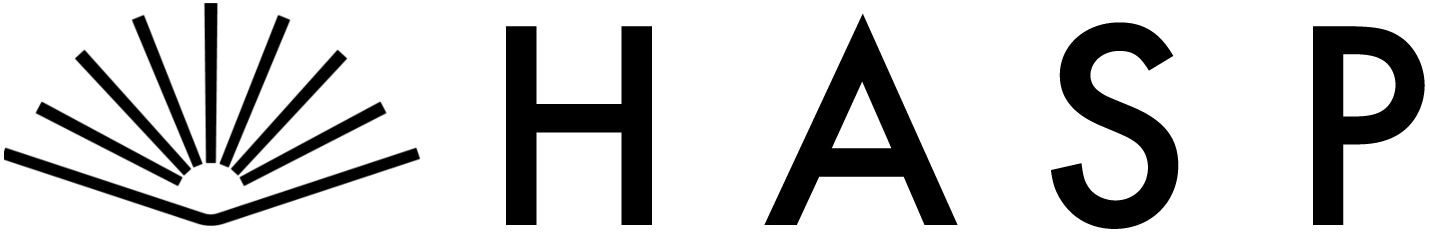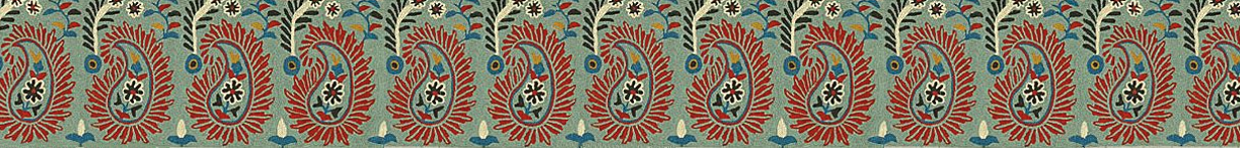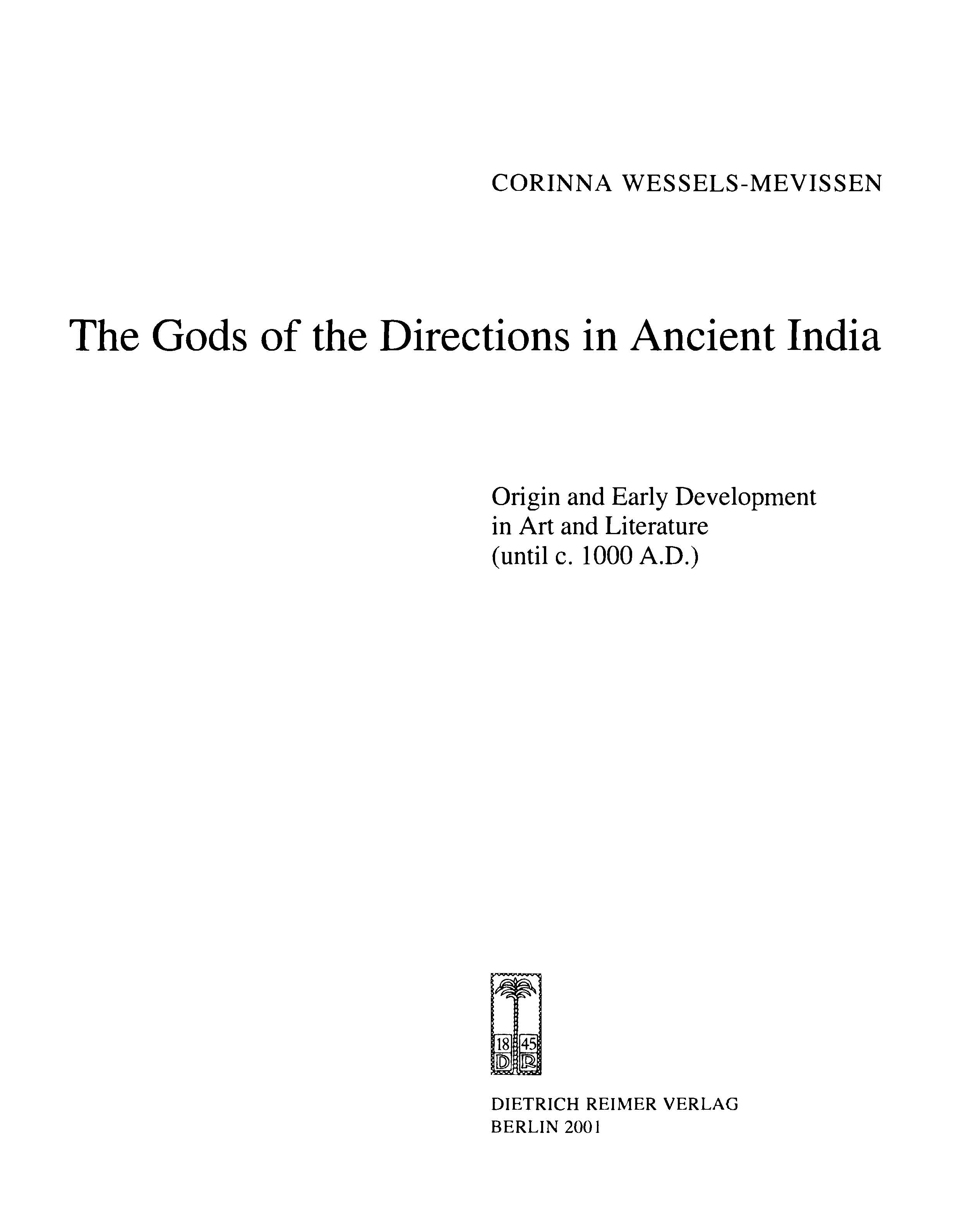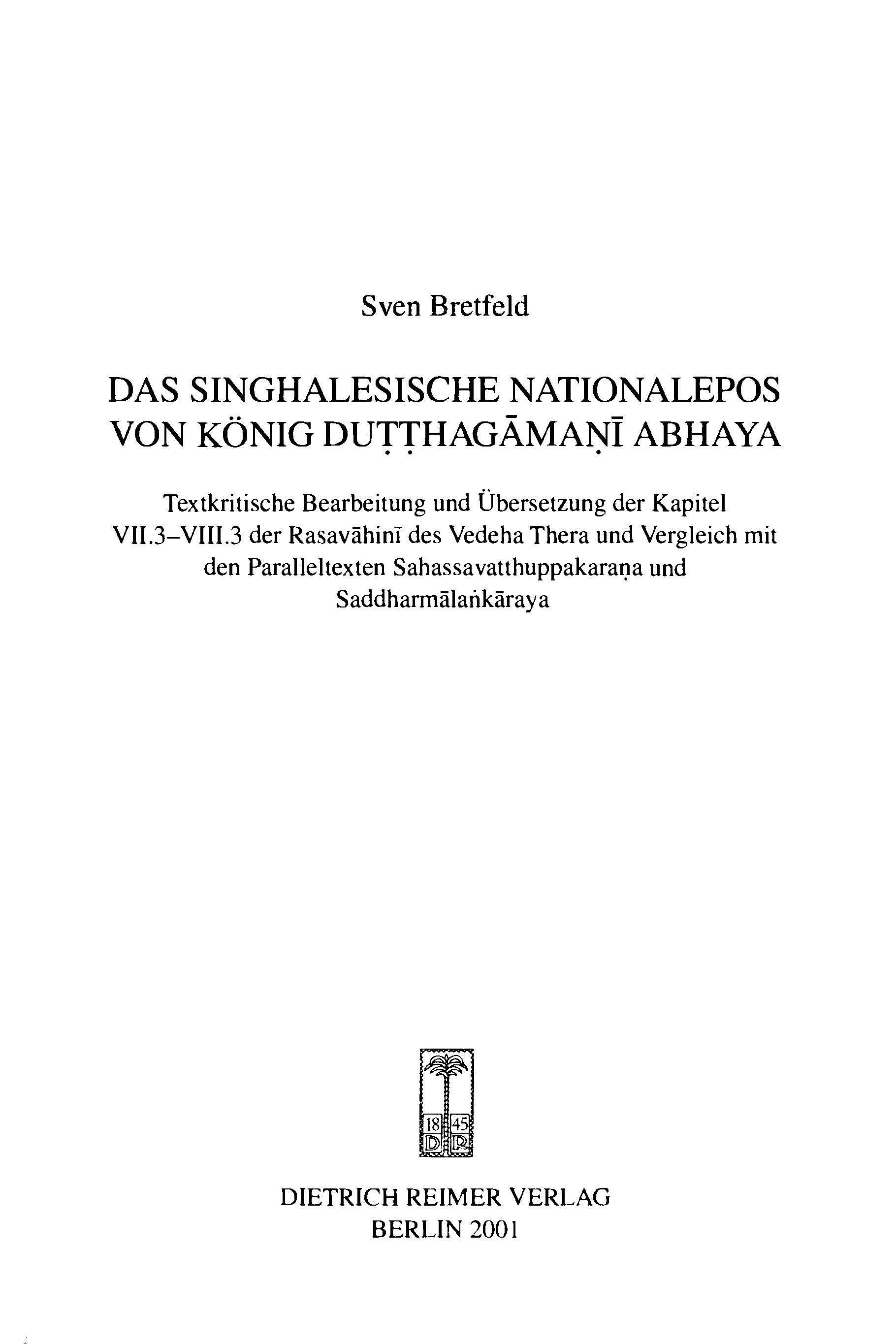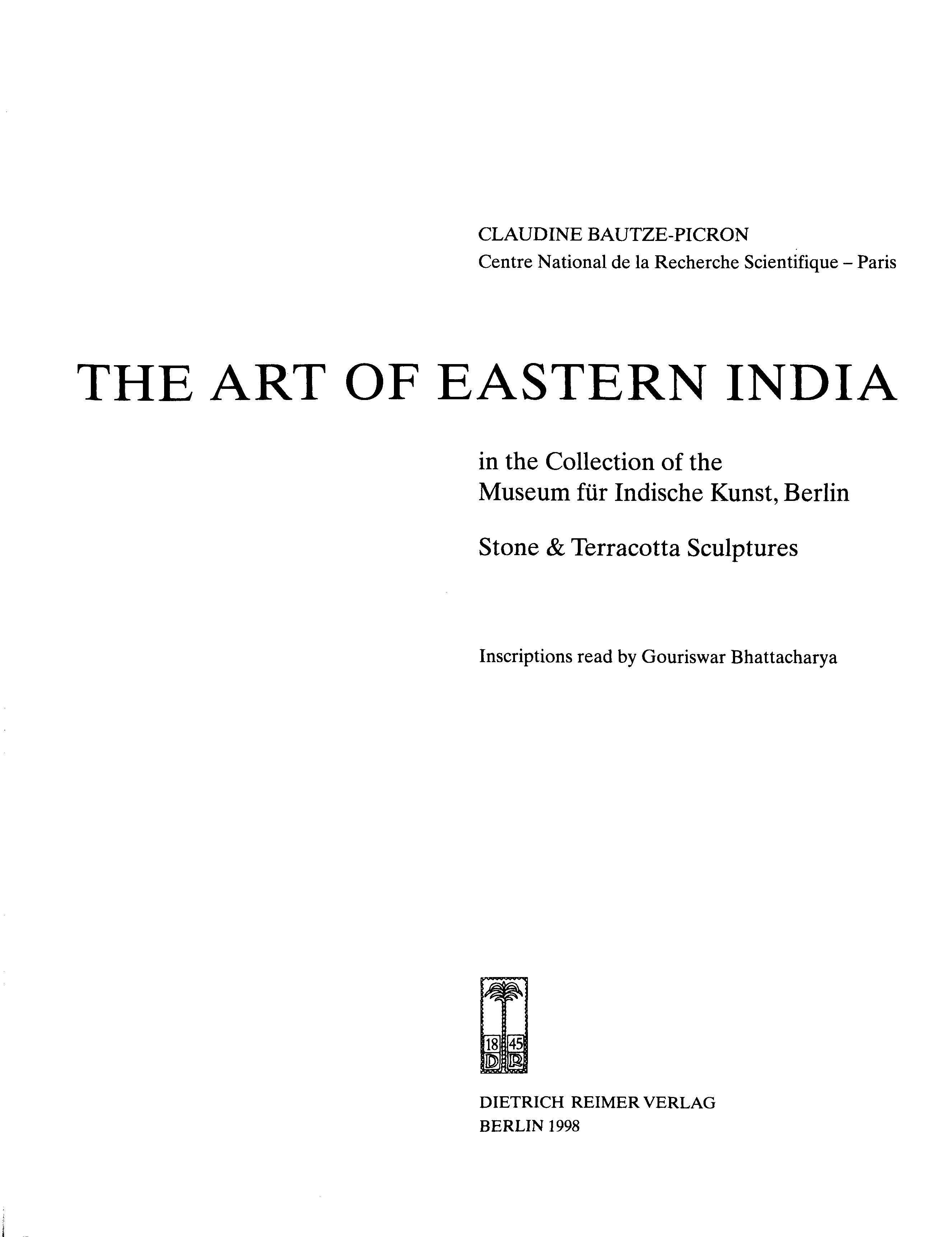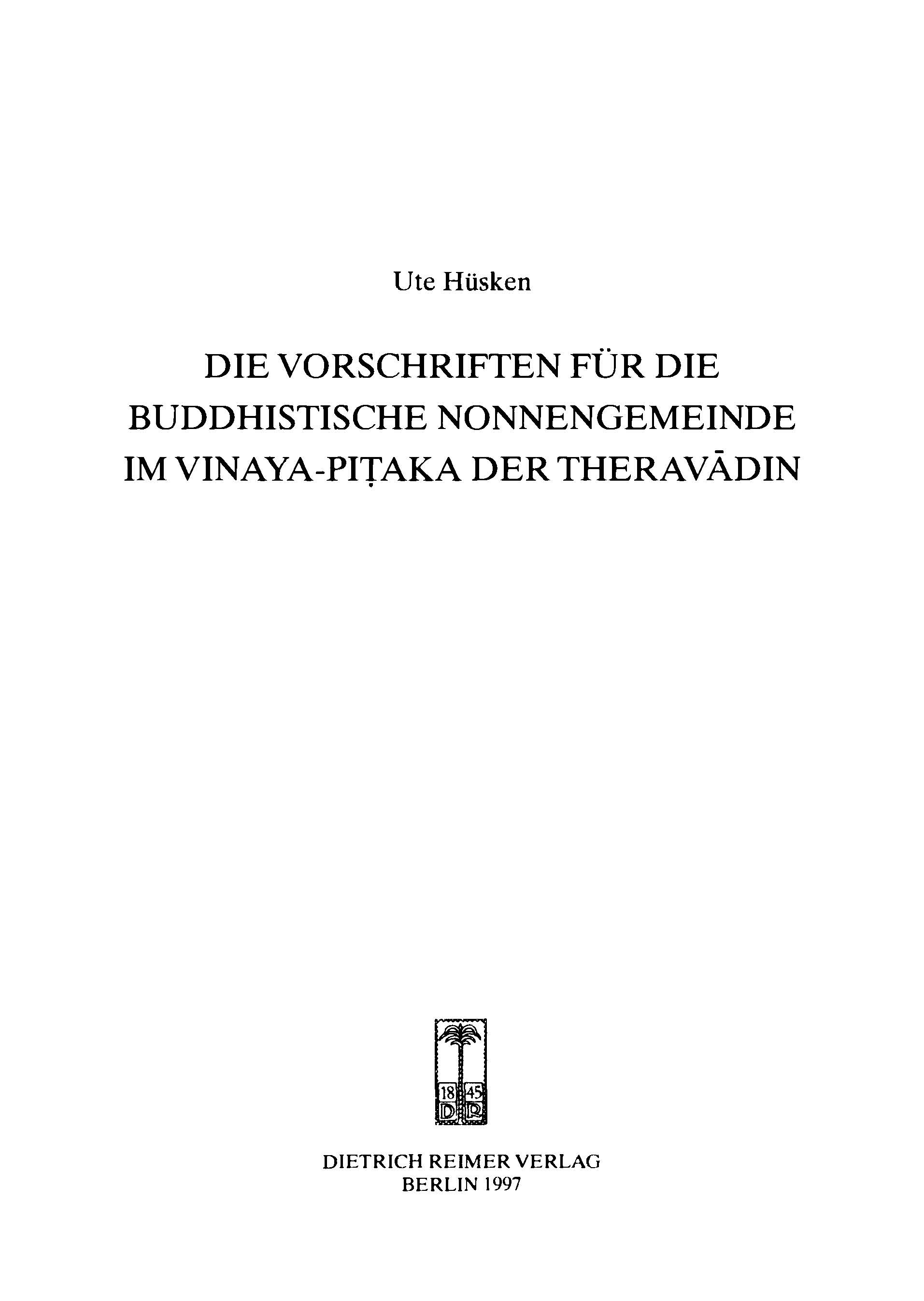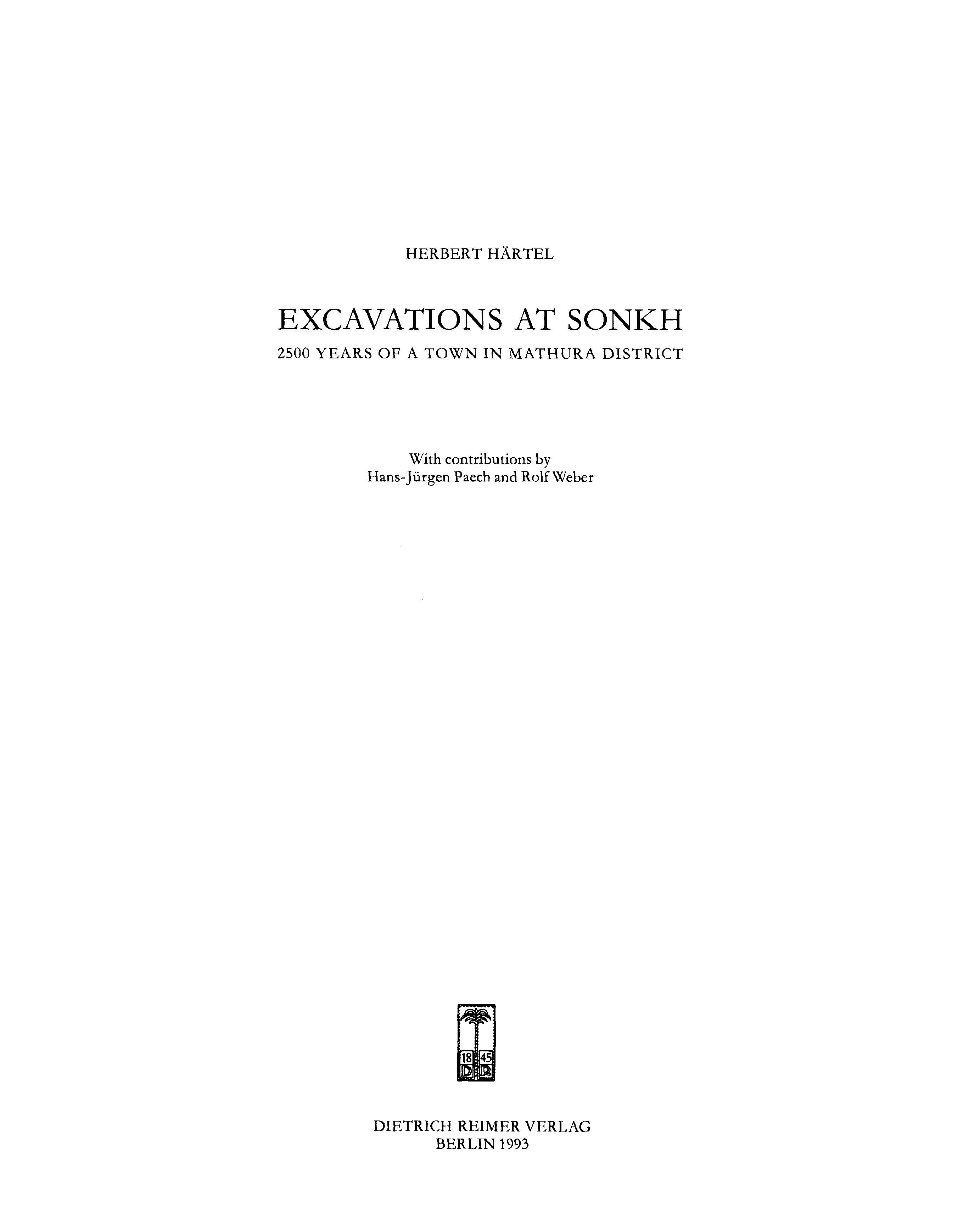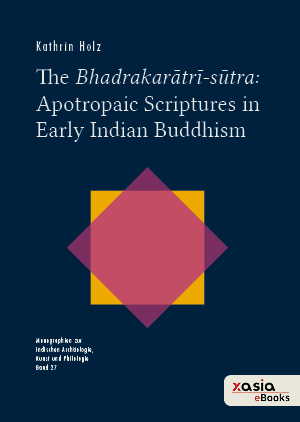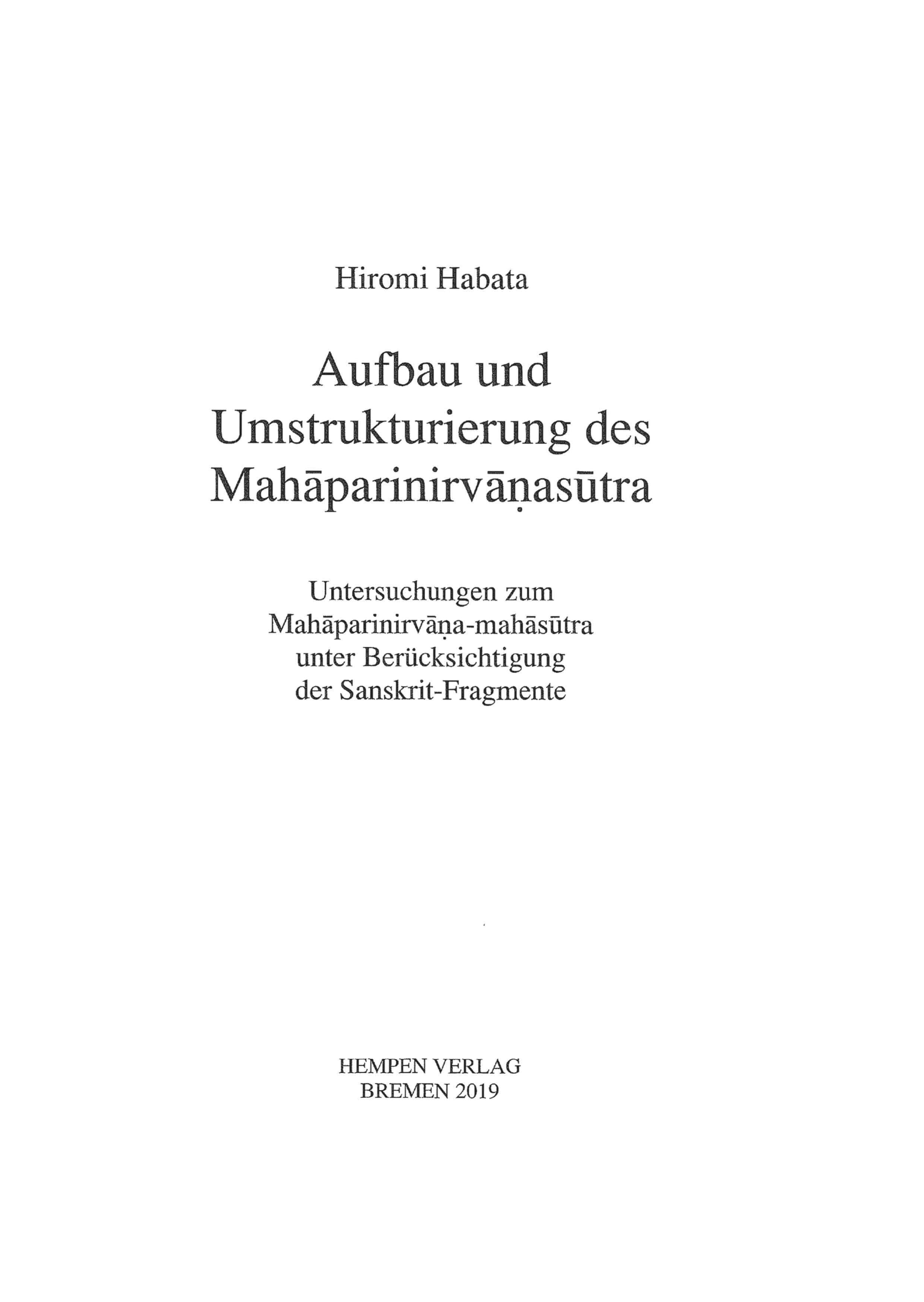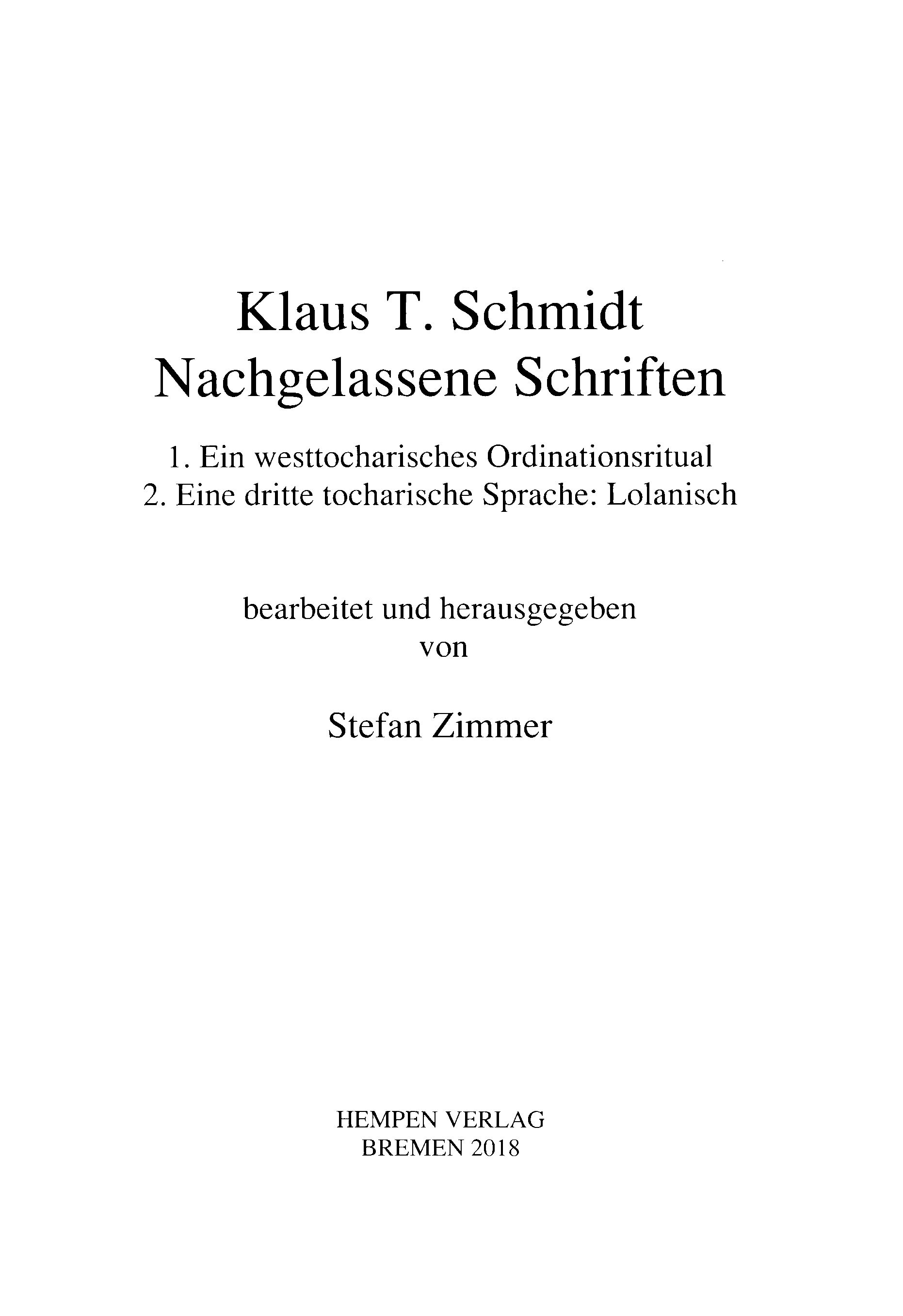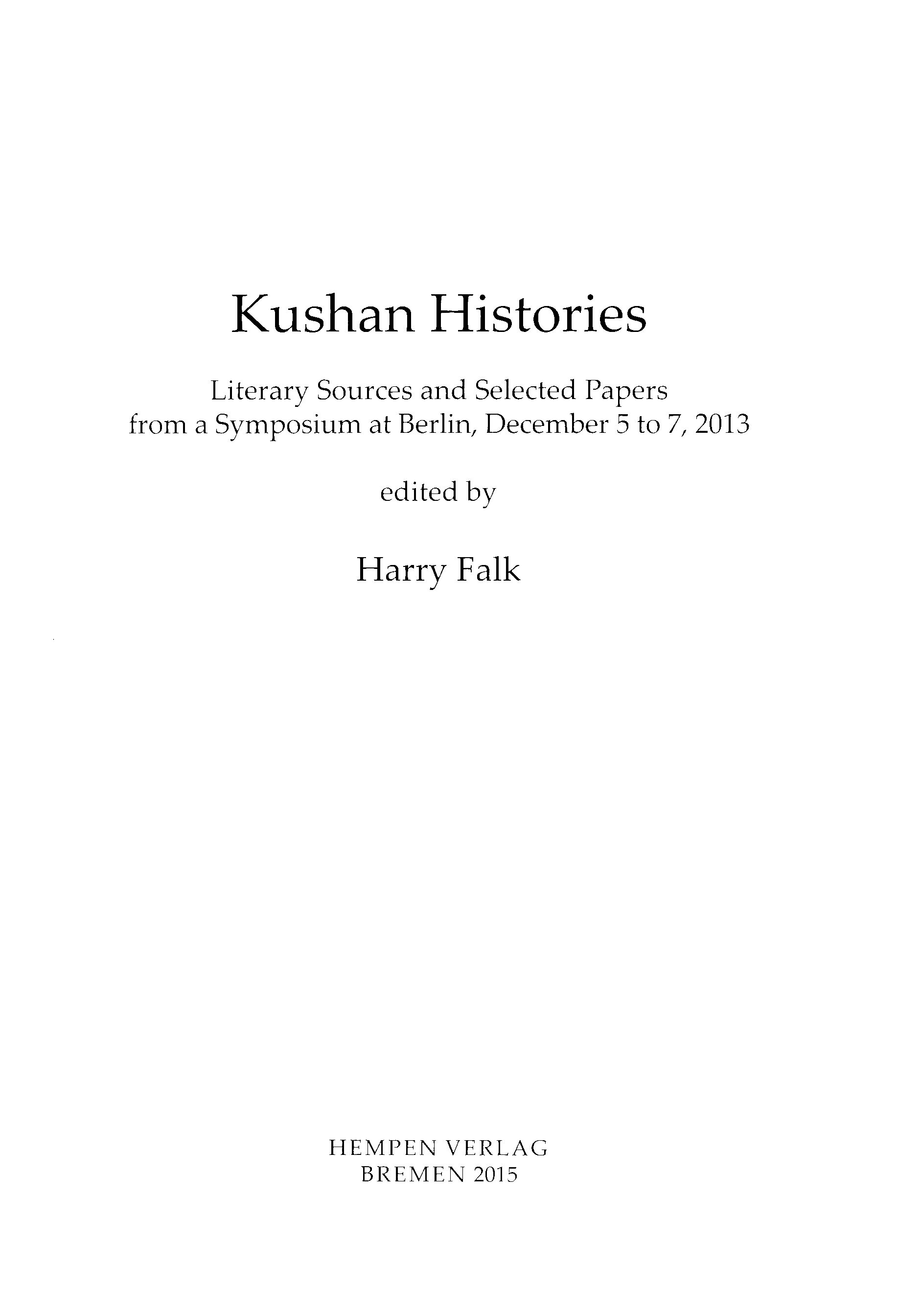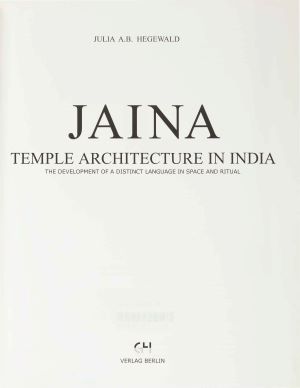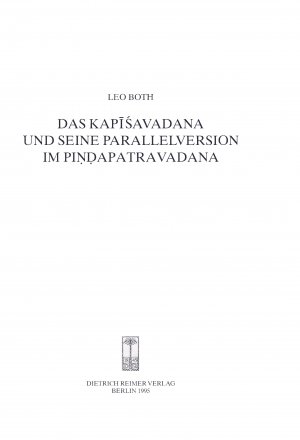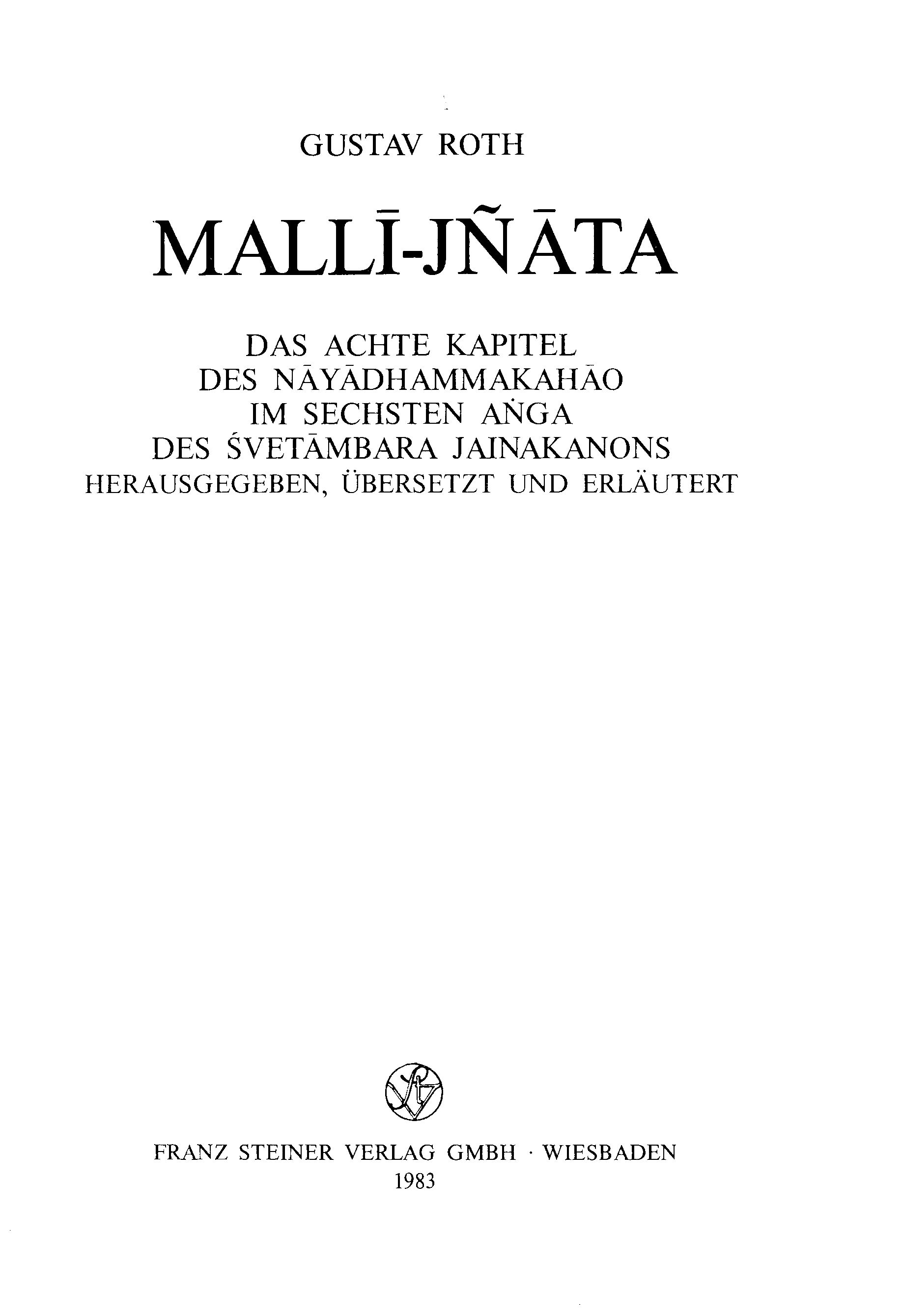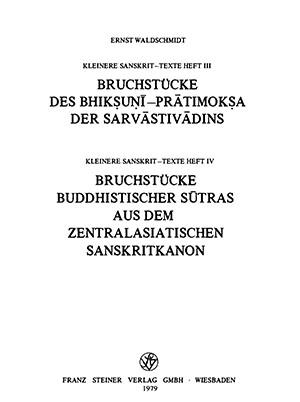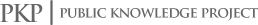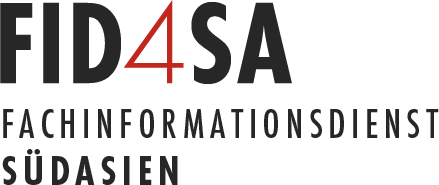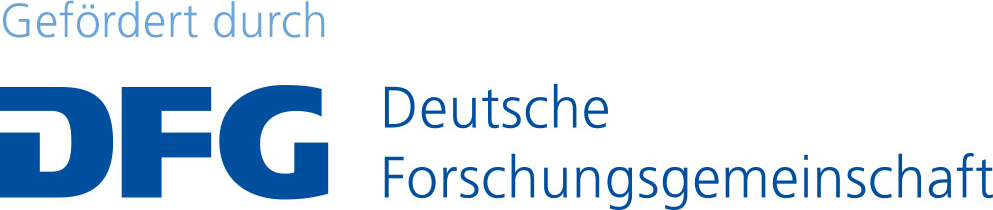Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie
Die Serie “Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie” wird seit 1978 vom Stiftungsrat der Stiftung Ernst Waldschmidt herausgegeben. Sie umfasst herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Indologie in ihrer gesamten Breite, mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Forschungsinteressen des Stifters (Archäologie und Kunstgeschichte Zentralasiens, buddhistische Literatur). Über die Aufnahme in die Reihe entscheidet der Vorstand der Stiftung auf Vorschlag des Stiftungsrats.
Die Stiftung Ernst Waldschmidt Berlin wurde im Jahre 1968 vom Indologen Ernst Waldschmidt (1897-1985) gegründet. Sie ist eine bürgerlich-rechtliche Stiftung nach Berliner Landesrecht mit Sitz in Berlin und dient der Unterstützung der Indienforschung in Deutschland.
Bisher erschienen
The Gods of the Directions in Ancient India: Origin and Early Development in Art and Literature (until c. 1000 A.D.)
Die Ursprünge und vielfältigen Entwicklungsstränge des Konzepts der - zumeist acht - Richtungsgottheiten (dikpalas) in der Literatur und vor allem in der Kunst Indiens werden in dieser umfassenden Studie anhand eines umfangreichen Abbildungsteils beschreibend und analysierend vorgestellt. Aus dieser Behandlung des Stoffes ergeben sich neue Erkenntnisse in der ikonographischen Forschung zur figurativen Kunst Indiens.
Das singhalesische Nationalepos von König Duṭṭhagāmaṇī Abhaya: Textkritische Bearbeitung und Übersetzung der Kapitel VII.3-VIII.3 der Rasavāhinī des Vedeha Thera und Vergleich mit den Paralleltexten Sahassavatthuppakaraṇa und Saddharmālaṅkāraya
Eine eingehende Erforschung der maßgeblichen „mittelalterlichen" Bearbeitung des Stoffes des singhalesischen Nationalepos - in Pāli als größte zusammenhängende Sammlung von Erzählungen in der Rasavähinī von Vedeha und in singhalesischer Sprache in der erweiterten Bearbeitung von Dharmakīrti - wird nun erstmals in der vorliegenden Arbeit von Sven Bretfeld vorgelegt. Die Bedeutung dieses Stoffes für die Südasienforschung geht weit über den Bereich der reinen Texterschließung hinaus: Im Mittelpunkt dieses Textes steht der seit mehr als zwei Jahrtausenden bestehende Konflikt zwischen Singhalesen und den aus Südindien zugewanderten Tamilen. Es ist eben dieser Konflikt, der im positiven Sinne zum Ursprung der Geschichtsschreibung im indischen Kulturbereich, im negativen Sinn aber zum heutigen Bürgerkrieg in Sri Lanka geführt hat. So hat Sven Bretfeld mit diesem hier zum ersten Mal in einer wissenschaftlichen Ausgabe zugänglich gemachten und erstmalig übersetzten Text einen grundlegenden Beitrag sowohl für die traditionelle Indologie und Buddhismusforschung als auch für ein tieferes Verständnis der heutigen Situation in Sri Lanka geleistet.
The Art of Eastern India in the Collection of the Museum für indische Kunst, Berlin: Stone & Terracotta Sculptures
Der Katalog stellt die Steinskulpturen und Terrakotten aus Ostindien vor, die sich im Besitz des Museums für Indische Kunst, Berlin, befinden. Die Sammlung ist alt und wurde zu einer Zeit zusammengetragen, im 19. und frühen 20. Jh., als die einzigen anderen großen westlichen Institutionen, die Kunst aus Ostindien sammelten, das British Museum und das Victoria & Albert Museum waren, und sie ist in ihrer Bedeutung neben die Sammlung des British Museum zu stellen. Sie veranschaulicht spezifische Aspekte der Kunst Ostindiens, die nicht so häufig gesammelt werden, wie die Votivkaitya oder Votivplatten, die in Bodh Gayā gefunden wurden und normalerweise nicht beachtet werden.
Die Vorschriften für die buddhistische Nonnengemeinde im Vinaya-Piṭaka der Theravādin
Wohl gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends endete die Ordinationstradition der Nonnen der buddhistischen Theravāda-Schule. Dennoch werden auch die Verhaltensvorschriften der Nonnen, die ebenso wie die der Mönche als Buddhawort gelten, in der Sammlung der kanonischen Texte weiterhin überliefert. In der vorliegenden Untersuchung wird das Regelkonvolut für Nonnen der Theravāda-Tradition ausgehend von den besonderen Nonnenregeln im Buch der Ordensdisziplin (Vinaya-Piṭaka) und den relevanten Kommentarstellen in der Samantapāsādikā dargestellt und mit den Verhaltensvorschriften für die Mönche derselben Überlieferung verglichen. Die Arbeit ist eine überarbeitete Fassung der 1995 vom Fachbereich Historisch-Philologische Wissenschaften der Georg-August-Universität in Göttingen angenommenen Dissertation.
Excavations at Sonkh: 2500 years of a town in Mathura district
Der vorliegende Bericht über die Ausgrabungen am Grabhügel von Sonkh, Distrikt Mathura, enthält eine detaillierte Darstellung der materiellen Überreste, die in acht Saisons (1966-74) von einem Team deutscher Archäologen ausgegraben wurden. Das Team wurde vom Museum für Indische Kunst, Berlin, unter der Leitung des Autors entsandt. Das Buch ersetzt die mehr als 20 Kampagnen- und Vorartikel, die im Laufe der Jahre in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
Sūryās Hochzeit: Kohärenz von Text und Ritual im Ṛgveda (10.85)
Der Ṛgveda ist eine gegen 1000 v. Chr. angelegte Sammlung von gut tausend Sanskrit-Hymnen, die typischerweise einen hochpoetischen Stil aufweisen. Das in dieser Sammlung überlieferte Sūryāsūkta (Ṛgveda 10.85) gilt jedoch als lose strukturierte Zusammenstellung hochzeitsbezogener Strophen.
Im vorliegenden Buch stellt Anne Keßler-Persaud diese grundlegende Annahme zum Textualitätsgrad des Sūryāsūkta in Frage. Mithilfe textlinguistischer und hermeneutischer Verfahren belegt sie eine hohe Kohärenz dieses Textes. Das Sūryāsūkta zeigt eine ausgefeilte metrische und rhetorische Struktur, und kommuniziert auf poetische Weise einen gleichfalls kohärenten Ablauf des Hochzeitsrituals der Göttin Sūryā.
The Bhadrakarātrī-sūtra: Apotropaic Scriptures in Early Indian Buddhism
Dieses Buch untersucht das Bhadrakarātrī-sūtra, einen wichtigen Vertreter der frühen buddhistischen rakṣā-Literatur, und leistet damit einen Beitrag zur Erforschung dieser Literaturgattung. Diese Arbeit präsentiert schließlich eine Edition, Teilrekonstruktion und Übersetzung der beiden erhaltenen Sanskrit-Manuskripte, die in Zentralasien gefunden wurden sowie eine kritische Edition und Übersetzung der tibetischen Version dieses Textes. Besonderes Augenmerk wird auch auf die chinesischen und tibetischen Varianten der Mantras gelegt. Außerdem werden spezifische rakṣā-Elemente, formale Merkmale sowie sprachliche und semantische Muster des Bhadrakarātrī-sūtra hervorgehoben. Diese sind entscheidend für das Verständnis der Besonderheiten seiner Sprache sowie seiner textlichen Entwicklung und Einordnung in die rakṣā-Literatur.
Aufbau und Umstrukturierung des Mahāparinirvāṇasūtra: Untersuchungen zum Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra unter Berücksichtigung der Sanskrit-Fragmente
Die Geschichte über den Tod des Buddha ist uns in verschiedenen Texten überliefert. Eine Version, das Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra, ist einschlägig bekannt als einer der älteren Texte, die die sogenannte “Buddha-Natur-Theorie” vertreten, wonach alle Lebewesen die Natur Buddhas besitzen. Das Sūtra hat über die chinesischen Übersetzungen einen großen Einfluss auf den ostasiatischen Buddhismus ausgeübt. Jedoch ist das Sanskrit-Original nur in Fragmenten überliefert. Die Untersuchungen der Sanskrit-Fragmente beleuchten die Ursprünge dieser Theorie in Indien.
Nachgelassene Schriften: 1. Ein westtocharisches Ordinationsritual, 2. Eine dritte tocharische Sprache: Lolanisch
Der 2017 verstorbene Indogermanist und Tocharologe Klaus T. Schmidt hat zwei Buchmanuskripte hinterlassen: Seine Ausgabe des längsten westtocharischen Textes, eines Ordinationsrituals für buddhistische Mönche, sowie eine unvollendete Arbeit über die seit langem vermutete, aber bisher nicht nachgewiesene dritte tocharische Sprache, von Schmidt "Lolanisch" genannt. Zimmer hat beide Manuskripte vorsichtig redigiert und das zweite mit Abbildungen der von Schmidt bearbeiteten Textfragmente ergänzt. Schmidts Entzifferung des Lolanischen ist ein Meilenstein der Zentralasien-Forschung!
Kushan Histories: Literary Sources and Selected Papers from a Symposium at Berlin, December 5 to 7, 2013
Kushan Histories erörtert neue Forschungen zur Kushan-Dynastie und beruht auf einem Symposium, das vom 5. bis 7. Dezember 2013 in Berlin stattfand.
Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct Language in Space and Ritual
Jaina Temple Architecture in India ist die erste umfassende Studie der Sakralbauten der Jaina Religionsgemeinschaft. Die Monographie dokumentiert die Entwicklung und Eigenständigkeit der Tempelbauten der Jainas in ganz Indien und zeigt die ununterbrochene Kontinuität der Bautätigkeit von vorchristlicher Zeit bis zu Gegenwart auf. Das Besondere im jinistischen Tempelbau wird deutlich in der Ausformung des rituellen Raumes. Durch Bildung von komplexen Raumfolgen und multiplen Heiligtümern auf verschiedenen Nutzungsbenen entstehen Orte für zahlreiche Verehrungsobjekte. Die Architektur spiegelt das Spezifische des jinistischen Rituals aber auch mythologische und kosmologische Konzepte wider.
Die Lekhapaddhati-Lekhapañcāśikā: Briefe und Urkunden im mittelalterlichen Gujarat
Text, Übersetzung und Kommentar der Lekhapaddhati-Lekhapañcāśikā, ein anonymer, in Jaina- bzw. Gujarātī-Sanskrit verfasster Text aus dem mittelalterlichen Gujarat, der Muster von Urkunden und Briefen enthält.
Das Kapīśāvadāna und seine Parallelversion im Piṇḍapātrāvadāna
Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Fassung der 1992 von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn angenommenen Dissertation. Sie beinhaltet die Edition und Übersetzung des Kapīśāvadāna und dessen Parallelversion im Piṇḍapātrāvadāna sowie eine Einleitung mit drei Schwerpunkten:
1. die Zuordnung der verschiedenen Hss der beiden Avadānas zu den entsprechenden Fassungen und, soweit möglich, die Darstellung des Verhältnisses der verschiedenen Fassungen zueinander,
2. die vom Autor benutzten buddhistischen Erzählmotive und
3. die hybriden Sanskrit-Formen.
Die Sīmā: Vorschriften zur Regelung der buddhistischen Gemeindegrenze in älteren buddhistischen Texten
Die vorliegende Untersuchung ist die erweiterte Fassung meiner 1989 vom Fachbereich Historisch-Philologische Wissenschaften in Göttingen angenommenen Dissertation. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen, die jeweils in sich abgeschlossen und mit einer separaten Einleitung versehen sind. Der erste Teil dieser Arbeit (A) ist dem Terminus sīmā im Vinaya der Theravādin gewidmet. Dabei werden in einem ersten Abschnitt (I) die im zweiten Kapitel des Mahāvagga überlieferten Vorschriften zur Regelung der Sīmā untersucht, während in einem zweiten Abschnitt (II) die Anwendung des Terminus sīmā in alien übrigen Teilen des Vinaya behandelt wird. Teil A soll somit einen Überblick darüber vermitteln, welche Sīmā-Regelungen in dieser frühen Periode bereits in Kraft waren und wie sie angewendet wurden. Im zweiten Teil (B) wird sodann der Kommentar zu den Sīmā-Regeln im Vinaya, d. h. zu dem in A I behandelten Text, aus Buddhaghosas Samantapāsādikā bearbeitet. Hierbei werden zu einer Reihe von Textstellen auch die drei großen Vinayaṭīkās - Vajirabuddhiṭīkā, Sāratthadīpānī und Vimativinodanīṭīkā - herangezogen. In Teil C werden anhand der aus Gilgit stammenden Sanskrit-Handschrift des Vinayavastvāgama und der im Kanjur überlieferten tibetischen Ubersetzung die im Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier iiberlieferten Sīmā-Regeln der Mūlasarvāstivādin untersucht und mit den Regelungen der Theravādin verglichen.
Drei "Bundi"-Rāgamālās: Ein Beitrag zur Geschichte der rajputischen Wandmalerei
Mit dem vorliegenden Band wird ein Beitrag zur Geschichte der rajputischen Wandmalerei geleisten, indem drei Sequenzen von je 36 bisher unveröffentlichten Wandmalereien vorgestellt, ikonographisch bestimmt und datiert werden. Zwei der Sequenzen befinden sich in einem der Öffentlichkeit in der Regel unzugänglichen Teil des Palastes von Bundi, der Hauptstadt des gleichnamigen ehemaligen Fürstenstaates und heutigen Distriktes im Bundesstaat Rajasthan, die eine Malschule hervorgebracht hat, welche Seite an Seite mit der berühmten Malschule von Kangra im Pahari-Gebiet genannt wird. Mitunter wird dieser Malstil sogar zu den schönsten Malstilen der indischen Miniaturmalerei gerechnet.
Mallī-Jñāta: Das achte Kapitel des Nāyādhammakahāo im sechsten Aṅga des Śvetāmbara Jainakanons, herausgegeben, übersetzt und erläutert.
Das achte Kapitel des Nāyādhammakahāo im sechsten Aṅga des Śvetāmbara Jainakanons, herausgegeben, übersetzt und erläutert von Gustav Roth.
Bruchstücke des Bhikṣuṇī-Prātimokṣa der Sarvastivādins; Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon
Faksimile-Reproduktion der ursprünglich 1926 und 1932 bei der Deutsche Morgenländische Gesellschaft in Kommission bei F. A. Brockhaus erschienenen Werke "Bruchstücke des Bhikṣuṇī-Prātimokṣa der Sarvastivādins" und "Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon", zusammengefasst in einem Band.